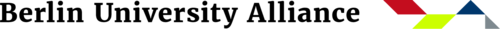„Forschungsjournale gehören in die Hände von Forschungseinrichtungen“
Prof. Dr. Vera Meyer ist Open-Access-Beauftragte der TU Berlin und engagiert sich seit vielen Jahren für den freien Zugang zu Forschungsliteratur. Foto: Martin Weinhold
Damit wissenschaftliche Daten und Literatur frei verfügbar und nutzbar sind, braucht es nicht nur die nötigen Infrastrukturen, sondern auch Forschende wie Vera Meyer, die ihre Arbeiten in Open-Access-Formaten veröffentlichen.
Prof. Dr. Vera Meyer ist Biotechnologin und Professorin für Angewandte und Molekulare Mikrobiologie an der Technischen Universität Berlin (TU Berlin). Seit 2016 ist sie Open Access-Beauftrage an ihrer Universität und setzt sich dafür ein, dass wissenschaftliche Veröffentlichungen frei zugänglich sind.
Frau Prof. Meyer, warum brauchen wir einen freien und kostenlosen Zugang zu Forschungsliteratur?
Dafür gibt es viele gute Gründe. Einer davon ist, dass unsere Wissenschaft gesellschaftlich über Steuermittel alimentiert ist. Deshalb sollten wir das Wissen der Gesellschaft auch frei zur Verfügung stellen. Damit ist nicht gemeint, dass man Patente verhindert oder Industriedaten freigibt. Wenn die Entscheidung fällt, die Daten in der wissenschaftlichen Community zu veröffentlichen, werbe ich dafür, dass auch Jede und Jeder außerhalb dieser Community diese Veröffentlichung lesen kann. Diese Daten sollten weltweit frei zugänglich sein, ob im Zug, zuhause, im Intranet oder im Café. Ein anderer Grund ist der wissenschaftliche Nachwuchs: Die Studierenden heute sind quasi mit dem Internet geboren und holen sich alle wichtigen Informationen von dort. Was dort nicht auffindbar ist, existiert für sie nahezu nicht. Open Access ist deshalb für die Lehre sehr wichtig und ermöglicht, dass aktuelle Forschungsergebnisse integriert und leicht von Studierenden nachvollzogen werden können.
Seit 2016 sind sie Open Access-Beauftragte der TU Berlin. Welche Meilensteine hat die Bewegung in den vergangenen Jahren bereits erreicht?
Im Jahr 2014 waren sieben Prozent aller Publikationen aus der TU Berlin Open Access. 2020 waren es berlinweit 64,6 %. Neue Daten zeigen, wie weit wir bereits vorangekommen sind: An der TU Berlin lag der Anteil da bereits bei über 72 Prozent. Open Access ist etabliert – das ist ein wirklich großer Meilenstein. Dieser Prozess hat ein paar Jahre gedauert und am Anfang war etwas Werbung notwendig, um Forschende davon zu überzeugen, öffentlich und freizugänglich zu publizieren.
Wie haben Sie die offenbar erfolgreiche Überzeugungsarbeit geleistet?
In jeder Fachdisziplin gibt es etablierte Publikationswege – also bestimmte Journale oder Verlage. Es gibt die sehr bekannten Spitzenjournale wie Nature oder Science, in denen eine Veröffentlichung quasi als Ritterschlag gilt. Das sollten wir überdenken. Denn das Journal ist nicht das entscheidende Qualitätskriterium, sondern es ist der Artikel selbst. Wird er häufig von anderen Forschenden zitiert? Beeinflusst er die künftige Forschung auf seinem Gebiet? Es ging am Anfang erst einmal darum, den Kolleginnen und Kollegen verständlich zu machen, dass es auch andere Publikationswege gibt und dass es sich lohnt, diese auszuprobieren. 2016 wurde ich Open Access-Beauftragte der TU Berlin. Wir sind damals durch alle Fakultäten gegangen, haben mit den Studierenden, internationalen Stipendiat:Innen und allen möglichen Einrichtungen gesprochen, um zu erklären, warum Open Access wichtig ist. Parallel dazu gab es auch eine politische Entwicklung: Die EU, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, der Berliner Senat und viele weitere Institutionen haben Förderprogramme aufgesetzt, in denen Open Access-Publikationen die Voraussetzung für eine finanzielle Förderung waren. Das hat natürlich sehr geholfen. Auf der anderen Seite beobachten wir jetzt jedoch einen kontinuierlichen Preisanstieg für Open-Access-Veröffentlichungen in kommerziellen Verlagen, der uns Sorgen macht.
Welche Bedenken gibt es gegenüber Open Access?
Viele Forschende haben die unbegründete Angst, dass ihr wissenschaftlicher Erfolg darunter leiden könnte. Aber das stimmt aus meiner Sicht und nach meinen Erfahrungen nicht. In einigen Forschungsfeldern gibt es auch noch keine Open Access-Journale und viele Forschende trauen sich nicht zu, ein eigenes zu gründen. Aber selbst dann kann man seine Veröffentlichung als Open Access zur Verfügung stellen: auf den sogenannten Repositorien der Universitäten, die die Werke maximal zwölf Monate nach Erstveröffentlichung als Zweitveröffentlichung ohne Zugangsbeschränkungen nutzbar machen. Auf dem Repositorium der TU Berlin „DepositOnce“ etwa sind bereits 5.000 solcher Zweitveröffentlichungen hinterlegt.
Wie verändert Open Access die Forschung?
Es gibt Daten, die zeigen, dass Open Access-Paper häufiger zitiert und im weiteren Forschungsprozess häufiger berücksichtigt werden. Denn sie sind leichter zugänglich. Der eigene Erkenntnisprozess kommt also schneller in der Wissenschaft und in der Gesellschaft an. Es ist entscheidend zu verstehen, dass man Teil einer Community ist. Wenn etwas leicht zu finden ist, kann ich selbst viel leichter recherchieren und schneller Wissen erlangen. Es wäre natürlich ideal und wünschenswert, wenn wir eines Tages einen Open Access-Anteil von 100 Prozent hätten.
Welche Schritte sind dafür noch notwendig?
Wissenschaftliches Publizieren beruht auf der Arbeit vieler Forschender: Wenn jemand selbst forscht, schreibt, gutachterlich tätig ist oder editiert, bekommt die Person für all das in der Regel kein Geld. Das große Geld mit wissenschaftlichen Publikationen verdienen die Verlage. Bei den sogenannten hybriden Journalen kann man gegen viel Geld – wir sprechen von mehreren Tausend Euro – das eigene Paper in Open Access umwandeln. Das ist ein marktwirtschaftliches Denken, das man aus meiner Sicht dringend hinterfragen sollte. Wir sollten uns mehr Gedanken darüber machen, wie wir freie Repositorien und Journale besser unterstützen können. Der mithilfe der Berlin University Alliance initiierte Verlag Berlin Universities Publishing (BerlinUP) ist ein Schritt in die richtige Richtung. Die ersten Universitätsverlage wurden in England bereits vor einigen hundert Jahren gegründet und sind mit dem Ziel angetreten, wissenschaftliches Wissen der Gesellschaft und den Forschenden anderer Universitäten zu vermitteln. Da müssen wir wieder hin. Forschungsjournale gehören in die Hände von Forschungseinrichtungen, nicht in die von Aktiengesellschaften.
Der von Ihnen erwähnte Verlag BerlinUP wurde 2019 als Publikationsplattform der vier BUA-Partnerinnen initiiert und wird nun, im Herbst 2023, offiziell als Verlag gegründet. Das erste Buch dieses Verlags stammt von Ihnen. Warum haben Sie sich für diesen Publikationsweg entschieden?
Ja, das ist das Buch „Engage with Fungi“, das ich 2022 veröffentlicht habe. Ein Teil meiner Forschung hat viel mit Citizen Science zu tun. Pilzbiotechnologie ist ein spannendes Forschungsfeld und trägt das Potenzial in sich, Märkte und Produktionsverfahren grundlegend zu verändern. Vielleicht wohnen wir künftig in Häusern, die aus Pilzen sind oder tragen nachhaltig produzierte Kleidung aus Pilzmaterialien. Ich denke, wir können Innovationen nur vorantreiben, wenn wir Gesellschaft, Wissenschaft und Kunst zusammenführen. Keiner von uns kann die Welt allein verstehen und verändern. Das können wir nur zusammen erreichen. Deshalb richtet sich das Buch an viele Akteure verschiedenster Disziplinen und Hintergründe. Der neue Verlag eignet sich hervorragend für diese Zielgruppe und auch für die Vernetzung von Forschenden aus den vier BUA-Häusern. Zugleich ist es ein Signal: Es gibt die neuen universitären Verlage, lasst sie uns als zentrale Veröffentlichungswege nutzen. Die erste Auflage des Buches ist übrigens bereits vergriffen, die zweite ist nachgedruckt. Das zeigt, dass dieser Publikationsweg sehr erfolgreich sein kann.