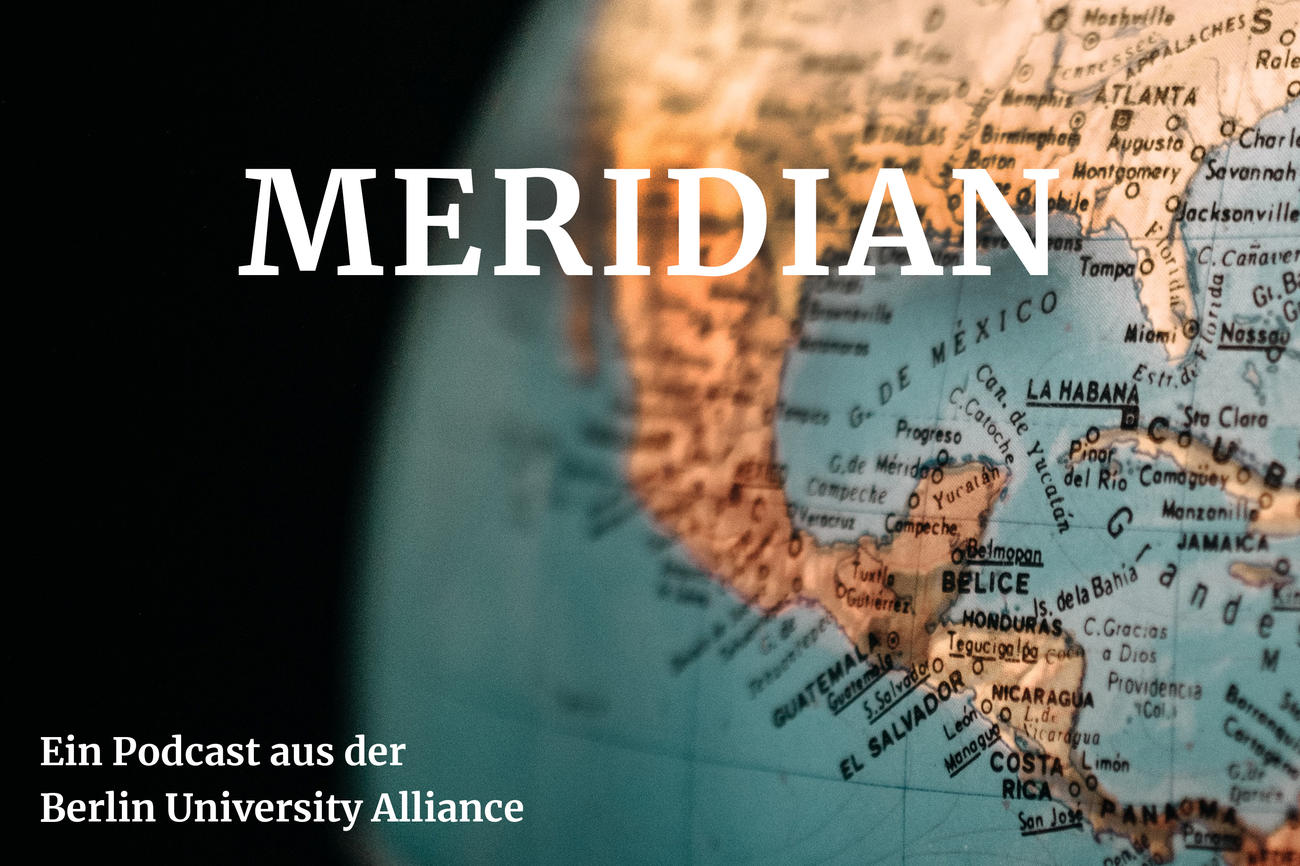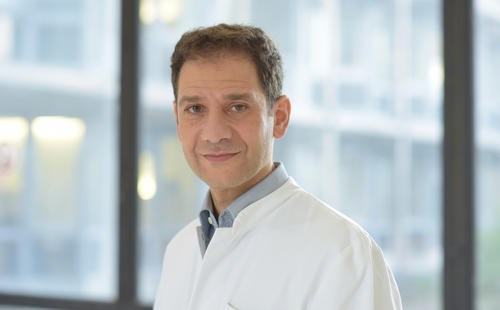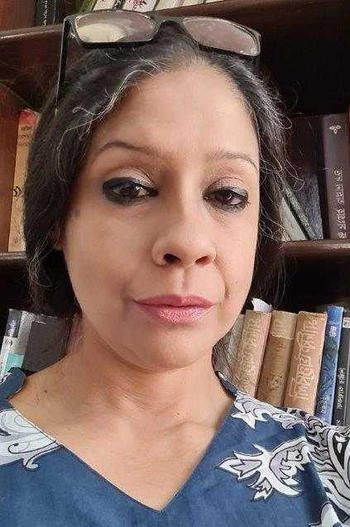Meridian
Der Wissenschaftspodcast des Berlin Center for Global Engagement (BCGE) – Forschende berichten von ihrer Arbeit zwischen verschiedenen Welten, von Berlin bis Dakar, von Rio de Janeiro bis Manila.
Meridian – Der Wissenschaftspodcast des Berlin Center for Global Engagement (BCGE)
Bildquelle: Unsplash/La Victorie
Mit dem Podcast stellt das BCGE die Arbeit von Wissenschaftler*innen vor, die sich mit Fragen der Zusammenarbeit zwischen dem Globalen Süden und dem Globalen Norden, der akademischen Freiheit und der Wissenschaftsdiplomatie auseinandersetzen. Die Forschenden sprechen unter anderem über ihr Interesse an ihrem Fach, die Kooperation mit Partnerinnen und Partnern im Globalen Süden sowie die aktuelle Forschung und Debatten dazu.
Meridian auf Spotify
Meridian auf Apple Podcasts
Meridian auf Google Podcasts
Meridian als RSS-Feed
Folge 20: Die unsichtbare Arbeit der Frauen: Gender, Arbeit und Nachhaltigkeit in Ghana und weltweit – mit Prof. Angela Dziedzom Akorsu
Angela Dziedzom Akorsu ist Professorin für Arbeits- und Geschlechterforschung an der University of Cape Coast in Ghana. Im Jahr 2025 ist sie DiGENet Audre Lorde Visiting Professor an der Berlin University Alliance, mit Gaststatus an der Freien Universität Berlin.
Die Podcast-Episode auf Spotify und Apple Podcasts.
Weltweit leisten Frauen die grundlegende Arbeit, die Gesellschaften am Laufen hält – und doch wird diese Arbeit häufig abgewertet oder unsichtbar gemacht. Von unbezahlter Pflegearbeit über prekäre Tätigkeiten in der informellen Wirtschaft bis hin zu neuen, durch digitale Plattformen geprägten Arbeitsformen: Frauen erfahren oft Marginalisierung, selbst in Systemen, die auf ihren Beiträgen beruhen. In Ghana und ganz Afrika sind diese Dynamiken tief in kolonialen Geschichten verwurzelt und werden durch den globalen Kapitalismus weiter verstärkt. Während die Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals) vorgeben, Geschlechtergerechtigkeit zu fördern, übersehen sie häufig die strukturellen Machtungleichheiten, die geschlechtsspezifische Arbeitsteilungen aufrechterhalten.
In dieser Episode spricht der Journalist Kevin Caners mit Professorin Angela Dziedzom Akorsu, außerordentliche Professorin für Arbeits- und Geschlechterforschung an der University of Cape Coast, Ghana, und 2025 DiGENet Audre Lorde Visiting Professor an der Berlin University Alliance. Gemeinsam gehen sie drängenden Fragen nach: Wie prägt die globale Arbeitsteilung geschlechtsspezifische Arbeitsstrukturen in Ghana? Welche Parallelen oder Unterschiede zeigen sich im Vergleich zu Europa – und was könnte Berlin daraus lernen? Wie können afrikanisch-feministische Perspektiven globale Debatten über Entwicklung, Nachhaltigkeit und Wissensproduktion herausfordern und neu gestalten? Und was ist erforderlich, damit Forschungskooperationen zwischen Afrika und Europa wirklich fair und gleichberechtigt sind?
Professorin Akorsus Karriere umfasst internationale wissenschaftliche Arbeit und interdisziplinäre Forschung. Sie erwarb ihren Bachelor in Erziehungswissenschaften an der University of Cape Coast (1998), ihren Master in Entwicklungsstudien am Institute of Social Studies in den Niederlanden (2001) und ihren PhD an der University of Manchester, Großbritannien (2010). Seit 2022 ist sie Dekanin der School for Development Studies an der University of Cape Coast. Ihre DiGENet Audre Lorde Visiting Professorship an der Berlin University Alliance, mit Gaststatus an der Freien Universität Berlin, beruht auf dem Engagement, Perspektiven zu stärken, die in gängigen Entwicklungsnarrativen häufig ausgeschlossen werden. Die Audre Lorde Visiting Professorship wurde vom Diversity and Gender Equality Network (DiGENet) der Berlin University Alliance ins Leben gerufen.
Wenn Sie mehr über Africa-Charter erfahren möchten, hören Sie die Meridian Folge 17: Die Afrika-Charter: Ein Fahrplan für Universitäten auf dem Weg zu gerechten Forschungspartnerschaften - mit Isabella Aboderin.
Folge 19: Die Demokratisierung von Wissen – Open Science von Lateinamerika in die Welt – mit Prof. Fernanda Beigel
Professorin Fernanda Beigel ist Soziologin am CONICET und an der Nationalen Universität von Cuyo in Mendoza, Argentinien, sowie ehemalige Vorsitzende des UNESCO-Beratungsausschusses für Open Science.
Die Podcast Episode auf Spotify und Apple Podcasts
Open Science ist eine Bewegung, die sich damit beschäftigt, wie Wissen produziert und geteilt wird. Sie zielt darauf ab, die langjährigen Barrieren abzubauen, die akademische Forschung hinter Bezahlschranken und innerhalb institutioneller Eliten eingeschlossen haben. Sie fordert mehr Transparenz, Inklusivität und Zugänglichkeit, um die globalen Wissenssysteme zu diversifizieren. Nur wenige Regionen haben Open Science so stark angenommen wie Lateinamerika. Wie ist der aktuelle Stand der Open-Science-Bewegung in dieser Region, und welche Risiken lassen sich beobachten? Wie kann Open Science dazu beitragen, globale Herausforderungen zu bewältigen? Und warum ist es essenziell, die Entstehung und Verbreitung von Wissen zu diversifizieren?
In dieser Folge geht Journalist Kevin Caners diesen Fragen gemeinsam mit Professorin Fernanda Beigel nach. Fernanda Beigel ist leitende Forscherin am Nationalen Rat für Wissenschaftliche und Technische Forschung Argentiniens (CONICET), Professorin an der Nationalen Universität von Cuyo (UNCuyo) und Direktorin des Forschungszentrums für Wissenszirkulation (CECIC). Von 2020 bis 2023 leitete sie das Nationale Komitee für Open Science in Argentinien und war von 2020 bis 2021 Vorsitzende des UNESCO-Beratungsausschusses für Open Science. Sie ist Hauptverantwortliche des Projekts Open Science in den Sozial- und Geisteswissenschaften in Argentinien und Deutschland: Chancen, Herausforderungen und Auseinandersetzungen, in Zusammenarbeit mit dem Ibero-Amerikanischen Institut und der Berlin University Alliance. Derzeit ist sie Fellow für Open Science an der Berlin University Alliance im Einstein Center for Digital Future.
„Projekte, die mit öffentlichen Mitteln finanziert werden, sollten auch für künftige Generationen oder andere Personen zugänglich sein, damit diese nicht die selben Daten sammeln. Sonst wird die Verbreitung von Wissen reduziert sowie konzentriert und damit asymmetrischer und ungleicher“, erklärt Fernanda Beigel.
Folge 18: Geburt in Brasilien: Gender und Politik im globalen Gesundheitswesen - mit Prof. Simone Diniz
Professor Simone Diniz ist Ärztin und Professorin an der Universität von São Paulo, Brasilien. Sie ist Audre Lorde-Gastprofessorin 2024/25 der Berliner Univerity Alliance.
Die Podcast Episode auf Spotify und Apple Podcasts
Überall auf der Welt sind die Gesundheitssysteme von Ungleichheiten geprägt - sowohl beim Zugang als auch bei der Frage, wie Geschlecht, Ethnie und soziale Schicht die medizinische Behandlung beeinflussen. Nirgendwo wird dies deutlicher als bei der Gesundheitsversorgung von Müttern. Von der Kinderbetreuung bis hin zu den reproduktiven Rechten werden die Erfahrungen von Frauen in der Gesundheitsversorgung durch Strukturen, politische Maßnahmen und Interessen bestimmt, die ihre Bedürfnisse oft nicht in den Vordergrund stellen. „Die Medizin geht oft von der Fehlerhaftigkeit des weiblichen Körpers und dem Glauben aus, dass Frauenkörper der Technik unterlegen sind“, erklärt Simon Diniz. Was bestimmt die Strukturen des Gesundheitswesens? Wie haben Geschlecht, Ethnie und Klasse ihre Entwicklung geprägt? Welche Veränderungen sind notwendig, um den Bedürfnissen von Frauen und Gesellschaften besser gerecht zu werden? Und welche Rolle spielen die Wissenschaftler in diesem Zusammenhang? Brasilien ist ein besonders interessantes Beispiel für die Erforschung dieser Fragen, da seine Geschichte der Entwicklung des Gesundheitssystems - an der Schnittstelle von Aktivismus, Forschung und Politik - gut dokumentiert ist.
Professor Simone Diniz ist eine anerkannte Expertin für öffentliche Gesundheit und Verfechterin der Gesundheit von Frauen, der Gleichstellung der Geschlechter und der sozialen Gerechtigkeit. Die ausgebildete Ärztin und ordentliche Professorin an der Universität von São Paulo (Brasilien) ist spezialisiert auf Präventivmedizin, Müttergesundheit, sexuelle und reproduktive Rechte, Datenwissenschaft und Gerechtigkeit in Gesundheitssystemen. Ihre umfangreiche Arbeit verbindet Wissenschaft, Politik und Aktivismus, darunter zwei Jahrzehnte mit dem São Paulo Feminist Collective on Health and Sexuality.
„Fakten reichen nicht aus, um die Realität zu verändern“, sagt Simone Diniz.
Folge 17: Die Afrika-Charter: Ein Fahrplan für Universitäten auf dem Weg zu gerechten Forschungspartnerschaften - mit Isabella Aboderin
Prof. Isabella Aboderin, Lehrstuhl für Afrika-Forschung und -Partnerschaften und Direktorin des Perivoli Africa Research Institute (PARC), Professorin für Gerontologie an der School for Policy Studies der Universität Bristol
Die Podcast Episode auf Spotify und Apple Podcasts
Die Afrika-Charta für transformative Forschungszusammenarbeit, die im Juli 2023 in Windhoek, Namibia, ins Leben gerufen wurde, ist ein auf Afrika ausgerichtetes Rahmenwerk zur Einführung einer transformativen Form der Forschungszusammenarbeit. Die Charta, die von den wichtigsten afrikanischen Hochschulgruppen mitgestaltet wurde, ist eine große kollektive Anstrengung, um die Machtasymmetrien im globalen Wissenschaftssystem und seine erheblichen Auswirkungen auf die internationale Politik und Wirtschaft anzugehen. Ende 2024 unterzeichnete die Berlin University Alliance die Afrika-Charta und schlug damit ein neues Kapitel der Zusammenarbeit mit dem „Globalen Süden“ auf.
In dieser Folge diskutiert der Journalist Kevin Caners mit Isabella Aboderin, Initiatorin der Afrika Charta, über die Ursachen und Auswirkungen der globalen Machtasymmetrien in der Wissensproduktion, wie die Afrika Charta entstanden ist und wie Hochschulen und Forschungseinrichtungen einen Fahrplan entwickeln können, um gerechte Forschungspartnerschaften Schritt für Schritt in die Praxis umzusetzen. „Die Berlin University Alliance hat das Potenzial, eine Vorreiterrolle bei der Förderung des Diskurses und der Arbeit rund um die transformativen Kooperationen mit Afrika im deutschen Raum zu spielen“, sagt sie.
Professor Isabella Aboderin ist Inhaberin des Lehrstuhls für Afrika-Forschung und -Partnerschaften und Direktorin des Perivoli Africa Research Institute (PARC), Professorin für Gerontologie an der School for Policy Studies der Universität Bristol und Sprecherin des Beirats des Berlin Center for Global Engagement an der BUA. Ihre Forschungen und ihr Engagement konzentrieren sich auf die Art und Notwendigkeit von Veränderungen in den Forschungsbeziehungen zwischen Afrika und dem globalen Norden, auf Fragen des Alterns sowie auf die Beziehungen zwischen den Generationen und die Pflege in afrikanischen Kontexten.
Folge 16: Mit Afrika rechnen: Die Welt durch Mathematik verändern - mit Dr. Dominic Bunnett und Marwa Zainelabdeen
Dominic Bunnett, Postdoc an der TU Berlin im Bereich algebraische Geometrie und Organisator des Programms Young African Mathematicians von MATH+, Marwa Zainelabdeen, Doktorandin der Mathematik am Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik & Freie Universität Berlin, MATH+ und Dozentin an der Universität von Khartum, Sudan
Die Podcast Episode auf Spotify und Apple Podcasts
Die Mathematik dient als Motor für Innovationen in einem breiten Spektrum von Anwendungen - von nachhaltiger Energie und Mobilität über Gesundheit bis hin zu künstlicher Intelligenz. Mathematiker*innen nutzen die ständig wachsenden Datenmengen, um mit anderen Disziplinen der angewandten Mathematik zusammenzuarbeiten und nach neuen Lösungen für wichtige zukünftige lokale und globale Herausforderungen zu suchen. Doch wie kann die Zusammenarbeit mit dem globalen Süden im Bereich der Mathematik zur Lösung globaler Herausforderungen beitragen? Wie sieht die internationale Zusammenarbeit, zum Beispiel mit Afrika, aus? Was machen Mathematiker*innen eigentlich und ist die Mathematik wirklich eine universelle Sprache? In dieser Folge diskutiert Kevin Caners mit Dr. Dominic Bunnett und Marwa Zainelabdeen. Beide sind an MATH+ beteiligt, einer Kooperation zwischen FU, HU und TU Berlin, dem Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS) und dem Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin (ZIB), die eng mit afrikanischen Institutionen wie dem African Institute of Mathematical Sciences (AIMS) zusammenarbeitet.
„Die internationale Zusammenarbeit ist der absolut wichtigste und angenehmste Teil der eigenen Forschung. Alleine kommt man nicht so weit. Man ist durch seinen eigenen Verstand begrenzt“, sagt Dominic Bunnett.
Folge 15: Weltweit kooperieren für das postfossile Zeitalter - mit Alexandra Krumm
Alexandra Krumm, Wissenschaftliche Koordinatorin des Transnational Centre for Just Transitions in Energy, Climate and Sustainability (TRAJECTS), Technische Universität Berlin
Die Podcast Episode auf Spotify und Apple Podcasts
Die Folgen des Klimawandels sind weltweit spürbar und fallen zunehmend drastisch aus. Trotz des immensen sozialen und politischen Drucks fällt es vielen Regierungen und Ländern schwer, den Ausstieg aus fossilen Energien, wie Kohle, zu planen und zu gestalten. Die Komplexität und internationalen Abhängigkeiten im fossilen Energiebereich sind oft so groß, dass die Gestaltung eines partizipativen und gerechten Wandels unmöglich scheint. Wie sehen diese internationalen Abhängigkeiten aus? Wie kann der Energiewandel gestaltet werden, damit der Ausstieg aus fossilen Energien auch weltweit gelingt? Wie wurde beispielweise der Kohleausstieg in Deutschland organisiert und wie können andere Länder von dem Wissen darüber profitieren? Wie diskutiert man fossile Energien in anderen Kontexten und was kann man in Deutschland davon lernen?
In dieser Episode diskutiert Philipp Eins mit Alexandra Krumm über neue Formen der wissenschaftlichen Zusammenarbeit, um die globale Energiewende gerecht und nachhaltig zu gestalten. Das kollaborative deutsch-kolumbianisch-südafrikanische Forschungsprojekt TRAJECTS bringt Universitäten und rund 40 weitere Akteur*innen aus Zivilgesellschaft, Forschung und Privatwirtschaft zusammen. Im Mittelpunkt stehen Maßnahmen für den Klimaschutz wie der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen sowie Änderungen in der Landwirtschaft und im Ökosystemschutz.
Alexandra Krumm ist akademische Co-Koordinatorin von TRAJECTS an der Technischen Universität Berlin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Europa-Universität Flensburg. In ihrer Promotion beschäftigt sie sich mit der Energiewende und dem Kohleausstieg in Deutschland und Indien mit einem Schwerpunkt auf Partizipationsmöglichkeiten von Akteur*innen und der Integration von sozialen Aspekten in die Energiemodellierung.
Folge 14: Kollektives Träumen für eine Welt in der Krise: Neue Visionen für eine nachhaltige Zukunft in Indien - mit Ashish Kothari
Ashish Kothari, indischer Umweltaktivist, Kalpavriksh, Pune/Indien und co2libri Fellow bei der Berlin University Alliance
Die Podcastfolge auf Spotify und Apple Podcasts
Die Menschen fühlen sich zunehmend überfordert und hilflos angesichts der vielen politischen, wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Krisen, mit denen die Welt derzeit konfrontiert ist - von globaler Erwärmung, Umweltverschmutzung und Verlust der Artenvielfalt bis hin zu Krieg, Autoritarismus, Landraub, Ungleichheit und Entbehrungen. Visionen und Auswege aus den Krisen sind gefragt, können aber nicht in denselben Paradigmen des Patriarchats, des Kapitalismus und des Rassismus liegen, die sie verursacht haben. Die weltweit vorherrschende Vorstellung, dass Wirtschaftswachstum zum Wohlergehen der Menschen führt, ist gescheitert, argumentiert der Umweltschützer Ashish Kothari. Was aber sind alternative Ideen, um wirtschaftliches und soziokulturelles Wohlergehen im Einklang mit der Natur zu gewährleisten? Was können Einzelne und lokale Gemeinschaften tun, um den globalen Herausforderungen durch radikale Demokratie und lokale ökologische und wirtschaftliche Sicherheit zu begegnen? Welche Rolle spielt die Umweltbewegung in Indien und wo liegen die Unterschiede zur deutschen Bewegung? Was kann der "Globale Norden" vom "Globalen Süden" lernen?
In dieser Meridian-Folge diskutiert Kevin Caners mit Ashish Kothari über neue Theorien und Praktiken in Indien und dem "Globalen Süden" für eine nachhaltige Zukunft. Kothari stellt die jüngsten Entwicklungen in lokalen Gemeinschaften vor und zeigt, wie sie es erfolgreich geschafft haben, die Lebensbedingungen mit der Natur und nicht gegen sie zu verbessern.
Ashish Kothari ist Gründungsmitglied von Kalpavriksh und lehrte am Indian Institute of Public Administration. Er koordinierte Indiens nationalen Strategie- und Aktionsplan für biologische Vielfalt, war im Vorstand von Greenpeace International und Indien, im ICCA-Konsortium sowie als Richter am Internationalen Tribunal für die Rechte der Natur tätig. Er hilft bei der Koordinierung des Vikalp Sangam (Alternatives Confluence) Prozesses in Indien und des Global Tapestry of Alternatives. Er ist Mitautor/Mitherausgeber von Churning the Earth, Alternative Futures und Pluriverse: A Post-Development Dictionary. Im Jahr 2023 war er Mercator-Stipendiat an der Universität Kassel, Deutschland.
Folge 13: Forschungszusammenarbeit neu denken: Bewältigung globaler Herausforderungen in einer ungleichen Welt - mit Adam Habib
Prof. Dr. Adam Habib, Direktor der SOAS Universität London
Die Podcastfolge auf Spotify und Apple Podcasts
Klimawandel, Pandemien, Massenmigration - die Welt ist voller komplexer und miteinander verbundener Probleme. Um sie zu lösen, ist eine intensive internationale Zusammenarbeit in der Forschung und darüber hinaus erforderlich. Doch die Kooperation mit Partnern in ärmeren Kontexten ist immer noch begrenzt und wird oft von Wissensregimen aus Institutionen des globalen Nordens dominiert. Warum ist sie jedoch so wichtig für die Zukunft? Wie kann sie auf gerechte Weise organisiert werden? Wie kann die Hochschulbildung für eine globalisierte und gerechtere Welt neu konzipiert werden?
In dieser Meridian-Folge diskutiert Kevin Caners mit Professor Adam Habib darüber, wie man globale Herausforderungen in einer ungleichen Welt angehen kann und warum es wichtig ist, globale Wissenschaft, globale Technologie und lokales Fachwissen zusammenzubringen.
Adam Habib ist der Direktor der SOAS Universität London und Mitbegründer der African Research Universities Alliance (ARUA). Zuvor war er Vizekanzler und Rektor der University of the Witwatersrand (Wits) in Johannesburg, Südafrika, wo er auch in Zeiten der Apartheid aufwuchs und sich als politischer Aktivist engagierte. Transformation, Demokratie und integrative Entwicklung sind grundlegende Themen seiner Forschung.
Folge 12: Unsichtbare Kriege und blinde Flecken: Auslandsberichterstattung und ihre Problemlagen – mit Carola Richter
Prof. Dr. Carola Richter, Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, Freie Universität Berlin
Die Podcastfolge auf Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts
Weltweit eskalieren Konflikte, Krisen und gar Kriege – viele entgehen der medialen Aufmerksamkeit oder werden nur gelegentlich erwähnt. In dieser Meridian-Episode geht es um Auslandsberichterstattung und vergessene oder unsichtbare Konflikte, wie beispielsweise im Jemen – laut den Vereinten Nationen einer der größten humanitären Katastrophen unserer Zeit. Es geht um Frage, was nicht berichtet wird und warum? Wie hat sich die Auslandsberichterstattung in Deutschland verändert und was hat dies für Konsequenzen in Bezug auf die Wahrnehmung internationaler Entwicklungen? Wie könnte eine verantwortungsvolle internationale Berichterstattung der Zukunft aussehen? Carola Richter ist seit 2011 Professorin für Internationale Kommunikation an der Freien Universität Berlin. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen auf Mediensystemen und Kommunikationskulturen im Nahen Osten und Nordafrika sowie Kriegs- und Auslandsberichterstattung. In ihrer Forschung setzt sie sich systematisch mit der Frage auseinander, wie die Welt in unseren Medien umfassender abgebildet werden kann. Seit einigen Jahren offeriert das von ihr mitgegründete Netzwerk AREACORE über die Plattform www.areacore.org/ims auch authentische Einblicke in Medienkulturen anderer Länder
Folge 11: Gerechtigkeit in der globalen Klimakatastrophe
Prof. Dr. Carl-Friedrich Schleussner, Geographisches Institut, Humboldt-Universität zu Berlin
Die Podcastfolge auf Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts
Achtzig Prozent der Emissionen, die für den Klimawandel verantwortlich sind, werden in den G20-Staaten produziert – während Länder, die bisher die größten Schäden der Klimakrise erleiden, nicht dazugehören. Die globale Klimakatastrophe ist in Teilen der Welt wie in den pazifischen Inselstaaten schon längst Realität. Ganze Inseln, und damit nicht nur Menschen, sondern auch Orte, Kulturen, Sprachen und Erinnerungen sind in ihrer Existenz bedroht. Wer haftet für die Verluste und das Leiden derer, die am wenigsten für den Klimawandel verantwortlich sind? Wie bemisst man einen existentiellen Schaden, der durch das Versäumnis anderer entsteht? Was tun Klimaforscher*innen und Wissenschaftler*innen im Kampf für mehr Gerechtigkeit in der Klimakrise? Der Klimaphysiker Prof. Dr. Carl-Friedrich Schleussner berichtet von seiner Forschung der ökonomischen, sozialen und naturwissenschaftlichen Phänomene des Klimawandels und wie man damit vulnerable Gruppen bei internationalen Klimaverhandlungen unterstützen kann.
Mareike Vennen, Institut für Kunstwissenschaft, Technische Universität Berlin, und Lennon Mhishi, Pitt Rivers Museum, University of Oxford
Bildquelle: privat
Folge 10: Die koloniale Vergangenheit von Museen erforschen
Eine Sonderfolge mit Mareike Vennen, Institut für Kunstwissenschaft, Technische Universität Berlin, und Lennon Mhishi, Pitt Rivers Museum, University of Oxford
Die Podcastfolge auf Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts
Im imperialen Zeitalter spielten Museen eine zentrale Rolle bei der oft gewaltsamen Aneignung von kulturellem Erbe, Naturalien und Rohstoffen. In den letzten Jahrzehnten haben sich Künstler*innen, Wissenschaftler*innen und Aktivist*innen kritisch mit dieser Geschichte auseinandergesetzt und die Museen aufgefordert, sich mit ihrem kolonialen Erbe auseinanderzusetzen und sich gegen Rassismus zu positionieren. In dieser Folge besuchen wir eine Veranstaltung der Berlin Science Week 2022 im Berliner Museum für Naturkunde. Umgeben von Tausenden von Steinen, die in der Mineralienhalle ausgestellt sind, fragen wir unsere Gäst*innen Mareike Vennen und Lennon Mhishi: Was kann ein Stück Quarz oder ein Dinosaurierknochen über koloniale Praktiken des Verschweigens der Vergangenheit erzählen?
Folge 9: E-Health in Madagaskar
Dr. Samuel Knauß, Klinik für Neurologie mit Experimenteller Neurologie der Charité – Universitätsmedizin Berlin
Die Podcastfolge auf Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts
Jeden Tag sterben in Madagaskar zehn Frauen an den Komplikationen einer Schwangerschaft oder bei der Geburt ihres Kindes. Einer der Gründe: Ein Großteil der Menschen in Madagaskar hat keine Krankenversicherung, die Kosten für eine medizinische Behandlung können sie nicht zahlen. Der Mediziner Samuel Knauß von der Berliner Charité wollte das so nicht hinnehmen. Gemeinsam mit seinem Kollegen Julius Emmrich und der madagassischen Ökonomin Elsa Rajemison haben sie eine App gebaut, die das Gesundheitswesen in Afrika auf den Kopf stellen könnte.
Folge 8: Ukrainische Universitäten im Krieg
Dr. Oksana Seumenicht, Research Development Manager, Max-Delbrück-Centrum und Managing Director der Deutsch-Ukrainischen Akademischen Gesellschaft e.V./UKRAINET
Die Podcastfolge auf Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts
Der russische Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 hat unermessliches Leid und Zerstörung verursacht, Tausende von Toten gefordert und Millionen von Ukrainer*innen gezwungen, ihr Land zu verlassen. Doch jenseits der dramatischen Berichte über die letzten Kampfhandlungen und Truppenbewegungen hat die Invasion auch Auswirkungen auf die vitalen Institutionen der ukrainischen Gesellschaft, einschließlich des Hochschulsystems. Wie kann man weiterarbeiten, wenn das eigene Land um sein Leben kämpft? In dieser Folge spricht Oksana Seumenicht, Geschäftsführerin der Deutsch-Ukrainischen Akademischen Gesellschaft, darüber, wie ukrainische Forschende und Studierende mit diesen außergewöhnlichen Umständen umgehen.
Folge 7: Klimaschutz made in Africa
Lilly Seidler, Projektkoordinatorin „Greening Africa Together“, Technische Universität Berlin, Institut für Energietechnik
Die Podcastfolge auf Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts
Ob verschmutztes Trinkwasser, Küstenstürme oder Ernteverlust durch unbestäubte Nutzpflanzen: Studien zufolge könnten bis zum Jahr 2050 rund fünf Milliarden Menschen unter den Folgen des Klimawandels leiden – ein Großteil davon im Globalen Süden. Klimaschutzprojekte zur Kompensation von Treibhausgasen bekämpfen idealerweise den Klimawandel und tragen zur nachhaltigen Entwicklung insbesondere im Globalen Süden bei. Aber warum müssen diese durch Auditoren aus dem Globalen Norden (teuer) zertifiziert werden? In dieser Folge spricht Lily Seidler über das Netzwerk Greening Africa Together, das eine afrikabasierte Zertifizierung von Klimaschutzprojekten mit lokal angepassten Standards, Kriterien und Indikatoren entwickelt.
Folge 6: Virtual Stories: The Digital Artistic Agency of Middle Eastern Children and Youth
Prof. Dr. Nazan Maksudyan ist Einstein-Gastprofessorin an der Freien Universität Berlin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Centre Marc Bloch (Berlin).
Die Podcastfolge auf Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts
In dieser Folge spricht Nazan Maksudyan über ihre Erfahrungen mit neuen digitalen Plattformen für virtuelle Kunst für Jugendliche und Kinder aus dem Nahen Osten. Das Projekt zielt darauf ab, Kanäle für Jugendliche aus dem Nahen Osten zu schaffen, um mit jungen Menschen in Europa und insbesondere in Berlin in Kontakt zu treten – und zwar durch interregionale Verbindungen, die von den Projektpartnern aufgebaut wurden. Im Rahmen eines Wettbewerbs des Projekts wurden Arbeiten eingereicht, die sich mit aktuellen globalen Herausforderungen wie der Pandemie, dem zunehmenden Autoritarismus, Erfahrungen im Exil und in der Diaspora sowie anderen Themen auseinandersetzen. Die Gewinner*innen können auf der Website von Virtual Stories eingesehen werden.
Folge 5: Mentale Gesundheitsforschung: zwischen Berlin und Amman
Prof. Dr. med. Malek Bajbouj, Geschäftsführender Oberarzt, Leiter Bereich Neurowissenschaften, Leiter Labor für Klinische Psychophysiologie der Charité – Universitätsmedizin Berlin
Die Podcastfolge auf Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts
Malek Bajbouj ist ein Grenzgänger in mehrfacher Hinsicht: In seiner Arbeit an der Charité verbindet er neue Ansätze der Psychotherapie mit neurowissenschaftlichen Methoden, um Depressionen zu lindern. Er selbst ist in Dortmund aufgewachsen, seine Eltern stammen aus Syrien. In dem BCGE geförderten Projekt „Berlin-Amman-Mental Health Alliance“ engagiert er sich für die Verbesserung der mentalen Gesundheit. Psychiatrie im Westen und im Nahen Osten: Unterschiede, Gemeinsamkeiten und Herausforderungen in der neuen Folge des Meridian Podcasts.
Folge 4: Grassroots Innovation in Technology – Discussing the Global Importance of Local Communities
(Graswurzelinnovationsbewegungen im Technologiebereich – Über die weltweite Relevanz lokaler Gemeinden)
Regina Sipos, Institut für Berufliche Bildung und Arbeitslehre an der Technischen Universität Berlin, Mitglied des Steering Committee am Centre for Internet and Human Rights, Mitglied des Executive Board der Berliner NGO „Global Innovation Gathering“ sowie Forschende im BCGE geförderten Projekt “Infrastructuring in Grassroots Innovation (IGI)“
Die Podcastfolge auf Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts (Englisch)
Die Bewältigung technologischer, ökologischer oder auch sozialer Herausforderungen durch lokale Gemeinden in abgelegenen Gebieten erfährt von Staat, Politik sowie Akteur*innen der internationalen Entwicklungszusammenarbeit oftmals wenig bis gar keine Berücksichtigung. Regina Sipos hingegen sieht solche Graswurzelbewegungen als wichtige Säule für nachhaltige soziale Innovationen. In dieser Podcast-Folge spricht sie unter anderem über ihre Forschung in ländlichen Regionen Indonesiens, über das häufige Scheitern von Großprojekten im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit und wie selbst kleine Maßnahmen in lokalen Gebieten wichtige Erkenntnisse zum Umgang mit globalen Herausforderungen liefern können.
Folge 3: Das Völkerstrafrecht und die deutsche Kolonialvergangenheit
Prof. Dr. Florian Jeßberger, Juristische Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin, Direktor des Franz von Liszt-Instituts für Internationales Strafrecht und Leiter des BUA-geförderten Projekts „International Criminal Justice: A Counter-Hegemonic Project?“
Die Podcastfolge auf Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts
Nicht nur die großen Seefahrernationen wie die Niederlande oder Großbritannien haben Kolonialverbrechen begangen, sondern auch Deutschland, zum Beispiel im heutigen Namibia, im südwestlichen Afrika. Beim Völkermord an den Herero wurden Anfang des 20. Jahrhunderts zwischen 65.000 und 80.000 Menschen von deutschen Truppen getötet. Ein Fall fürs Völkerrecht. Der Rechtswissenschaftler Florian Jeßberger hat eine andere Perspektive auf die Kolonialgeschichte. Er möchte das Völker-STRAF-recht in den Mittelpunkt stellen und sagt: Hier steht die Debatte noch am Anfang. Was er damit meint, verrät er in dieser Folge von Meridian.
Folge 2: Thinking about time and politics from a southern perspective
Die indische Historikerin Prof. Prathama Banerjee vom Centre for the Study of Developing Societies (CSDS) in Delhi spricht über umstrittene Konzepte in den Geisteswissenschaften. Sie hielt auch die zweite Berlin Southern Theory Lecture (Aufzeichnung auf YouTube).
Die Podcastfolge auf Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts (Enlisch)
Im Dezember 2020 fand die zweite jährliche „Berliner Southern Theory Lecture“ statt, die diesmal von Prathama Banerjee gehalten wurde. Ziel der Vortragsreihe ist es, vorherrschende euro-amerikanische Traditionen zu dezentralisieren und die theoretischen Debatten in den Sozial- und Geisteswissenschaften zu diversifizieren. Prathama Banerjee ist Geschichtsprofessorin am Centre for the Study of Developing Societies in Neu-Delhi (Indien) und veröffentlichte vor Kurzem ihr neuestes Werk „Elementary Aspects of the Political: Histories from the Global South“. Neben ihrer Tätigkeit als Historikerin für das koloniale und postkoloniale Indien, befasst sich Prathama Banerjee ebenso intensiv mit politischer Theorie. In diesem Podcast erzählt sie, wie es letztlich dazu kam, dass sie sich mit der Bedeutung von Konzepten wie „Geschichte“, „Zeit“ und „dem Politischen“ in unterschiedlichen Kontexten auseinandersetzte.
Folge 1: Architektur zwischen Rotterdam und Havanna
Prof. Dr. Jacob van Rijs, Institut für Architektur der Technischen Universität Berlin, beschäftigt sich aktuell mit Stadtentwicklung und Architektur in Havanna.
Die Podcastfolge auf Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts
Der Niederländer Jacob van Rijs hat das Architekturbüro MVRDV aus Rotterdam mitbegründet – laut Süddeutscher Zeitung eines der wagemutigsten Architektenbüros weltweit. Der niederländische Pavillon auf der Expo 2000 in Hannover hat Jacob van Rijs und sein Team bekannt gemacht. Später stapelten sie in ihrem Amsterdamer Wohnturm Silodam unterschiedliche Wohnungstypen übereinander, bis das Ganze aussah wie die Ladung eines Containerschiffes. Mittlerweile forscht Jacob van Rijs an der Technischen Universität Berlin. Und beschäftigt sich dort unter anderem mit Stadtentwicklung und Architektur in Havanna.