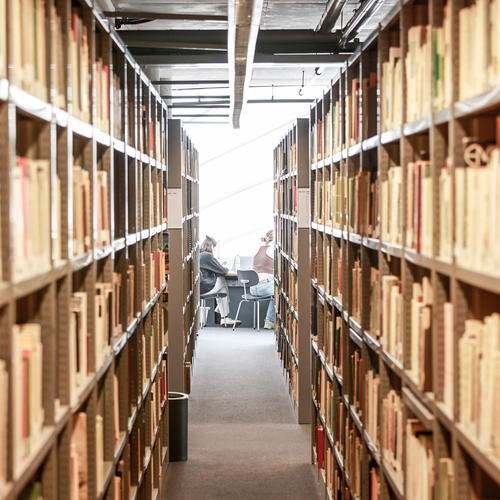„BerlinUP tritt für eine digitale Souveränität der Wissenschaft ein.“
Jürgen Christof ist Sprecher von Berlin Universities Publishing (BerlinUP), dem Open-Access-Verlag des Berliner Exzellenzverbunds. Im Interview spricht er über Diamond Open Access, die Zusammenarbeit der Berliner Universitäten und den Anspruch, Wissen ohne Hürden zugänglich zu machen.
In einer Zeit, in der wissenschaftliche Erkenntnisse noch zu oft hinter Paywalls verborgen bleiben, setzt Berlin Universities Publishing (BerlinUP) ein klares Zeichen für Offenheit. Der von der Freien Universität, der Humboldt-Universität, der Technischen Universität und der Charité – Universitätsmedizin Berlin gegründete Open-Access-Verlag macht Forschungsergebnisse weltweit frei zugänglich – ohne Gebühren für Autor*innen oder Leser*innen. Statt auf kostspielige Publikationsgebühren setzt BerlinUP auf das Prinzip des Diamond Open Access und eine institutionelle Finanzierung. Im Interview erklärt Jürgen Christof, derzeitiger Sprecher des Verlages und Direktor der Universitätsbibliothek der TU Berlin, wie BerlinUP den Zugang zu Wissen gerechter gestalten will und warum die vier Verbundpartnerinnen hier gemeinsame Wege gehen.
Können Sie uns kurz erklären, was BerlinUP ist?
BerlinUP ist ein wissenschaftlicher, nicht-kommerzieller Open-Access-Verlag für alle disziplinären Schwerpunkte der Berliner Forschungslandschaft. BerlinUP unterstützt die Forschenden mit Beratungsangeboten, die alle wesentlichen Aspekte des wissenschaftlichen Publizierens umfassen und stark an der Praxis orientiert sind. Insgesamt leistet der Verlag einen Beitrag zur Vielfalt der Publikationslandschaft und erweitert die Wahlmöglichkeiten bei der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen.
Darüber hinaus bieten Universitätsverlage folgende Vorteile: Sie sind an eine Forschungseinrichtung angebunden, das Verlagsprogramm spiegelt das Profil ihrer Einrichtung wider und Open Access steht im Vordergrund. Damit ein Verlag von den eigenen Wissenschaftler*innen anerkannt ist, muss er wissenschaftlich und formal hohe Qualität sichern - und dies transparent und ohne Gewinnabsicht tun.
Wie ist der Verlag entstanden?
Zur Gründung von BerlinUP kam es folgendermaßen: Im Feld von Open Access haben die Universitätsbibliotheken schon seit der gemeinsamen Arbeit an der Berliner Open-Access-Strategie im Jahr 2015 intensiv zusammengearbeitet. Nach der Veröffentlichung der Open-Access-Strategie des Berliner Senats gab es eine erste Machbarkeitsstudie, die sich mit der Publikationsstruktur an den Berliner Wissenschaftseinrichtungen beschäftigte. Daraus hat sich die Idee für ein kooperatives Open-Access-Dienstleistungsnetzwerk entwickelt. Mit dem Zuschlag für die Berlin University Alliance (BUA) in der Exzellenzstrategie 2019 gab es die Möglichkeit, dieses Netzwerk als Projekt zu fördern. Seit 2023 trägt sich der Verlag aus hauseigenen Mitteln der vier beteiligten Universitätsbibliotheken. Mit der Veröffentlichung von mittlerweile mehr als 20 Buchtiteln und dem Hosting von 12 Zeitschriften aus allen vier Einrichtungen ist der Verlag erfolgreich gestartet.
Was ist die Mission von BerlinUP?
BerlinUP treibt die Open-Access-Transformation im wissenschaftlichen Publizieren voran. Der Verlag ermöglicht den Wissenschaftler*innen der BUA-Einrichtungen, die Ergebnisse ihrer Forschungsaktivitäten qualitätsgesichert und im Open Access in Monografien und Zeitschriften zu veröffentlichen. Angehörige der Berlin University Alliance stellen mit BerlinUP ihre wissenschaftlichen Arbeitsergebnisse für die internationale Forschung und die interessierte Öffentlichkeit weltweit frei zur Verfügung. Dabei werden die spezifischen Anforderungen fachlicher Publikationskulturen berücksichtigt. Bei BerlinUP zu publizieren setzt keine hohe finanzielle Ausstattung einzelner Wissenschaftler*innen oder Forschungsprojekte voraus. Wir setzen uns mit BerlinUP bewusst ab von gewinnorientierten, kommerziellen Verlagen und streben ein für Publizierende und Lesende kostenfreies Publikationsmodell im Sinne von Diamond Open Access an.
Inwiefern unterscheidet sich BerlinUP von kommerziellen Verlagen?
BerlinUP hat es sich als wissenschaftsgeleiteter Verlag zum Ziel gesetzt, ein für Publizierende und Lesende kostenfreies Publikationsmodell zugrunde zu legen. Wir erfüllen mit unseren Strukturen die Forderungen von Wissenschaftsorganisationen und Fördereinrichtungen, unmittelbar frei zugängliche Erstpublikationen zu ermöglichen. Dazu haben wir wissenschaftsnahe Publikationsinfrastrukturen in den Bibliotheken geschaffen. Hier setzen wir uns vom Vorgehen kommerzieller Verlage ab: Diese erheben eine Gebühr, damit Bücher oder Artikel in Zeitschriften Open Access veröffentlicht werden können. Das ist quasi eine Bearbeitungsgebühr, die den Wegfall von Abogebühren kompensieren soll, aber vielfach weit über die Deckung von Kosten hinausgeht. Diese Gebühren liegen schnell im vier- bis fünfstelligen Euro-Bereich pro Artikel bzw. Buch.
Zudem gibt es bei BerlinUP das Versprechen, nur die für die Verlagsarbeit nötigen Daten zu erheben und mit diesen verantwortungsvoll umzugehen. Zu Recht werden große, kommerzielle Verlage für das umfassende Tracking und die Verwertung von Daten im Rahmen der Verlagsarbeit kritisiert, sowohl von Vertreter*innen der wissenschaftlichen Community als auch der DFG. BerlinUP schließt sich dieser Kritik an und tritt für eine digitale Souveränität der Wissenschaft ein.
Was bedeutet „Diamond Open Access“ konkret, und warum haben Sie sich für dieses Modell entschieden?
BerlinUP orientiert sich an internationalen Standards für diamantenes Open Access. Publikationen sind dabei sofort und weltweit frei zugänglich. Die Publikation von qualitätsgeprüften Beiträgen erfolgt ohne Kosten für Autor*innen und Leser*innen und unbedingt unter einer möglichst freien Lizenz. Wichtig ist zudem, dass der Verlag (oder einzelne Zeitschriften) der Wissenschaft gehören und mit ihnen grundsätzlich keine kommerziellen Zwecke verfolgt werden. Aus der Sicht von BerlinUP ist Diamond Open Access ein faires Modell: Es ermöglicht eine gebührenunabhängige Teilhabe am wissenschaftlichen Publizieren, stellt wissenschaftliche Werte wie Kooperation und Gemeinwohl in den Vordergrund und stärkt die wissenschaftliche Selbstverwaltung. Diamond Open Access ist damit ein nachhaltiges, qualitätsfokussiertes und gemeinwohlorientiertes Modell.
Warum ist Open Access für die BUA so wichtig?
Wir bewegen uns auf einem globalen Wissensmarkt. Gute Open-Access-Publikationen mit Qualitätskontrolle sorgen nachweislich für die Sichtbarkeit starker Forschung der eigenen Einrichtungen. Die BUA hat sich 2023 ein „Leitbild für eine Offene Wissenschaft“ gegeben, in dem Open Access als zentrales Handlungsfeld definiert ist. Die Grundidee ist einfach: Öffentlich finanzierte Forschung soll auch der Öffentlichkeit zugutekommen. Die BUA ist mit dem genannten Leitbild und den Initiativen zur Stärkung von Open Access auf der Höhe der Zeit, wenn wir die Positionen von nationalen und internationalen Wissenschaftsorganisationen betrachten. Hochwertige, qualitätsgesicherte Open-Access-Publikationen erhöhen die Reichweite der Berliner Forschung erheblich und sind ein wesentlicher Aspekt der Internationalisierung.
Was haben Sie bisher publiziert und was planen Sie für dieses Jahr noch?
Wie bereits erwähnt, hat BerlinUP seit dem Start aus allen vier BUA Einrichtungen mehr als 20 Buchtitel veröffentlicht, von geisteswissenschaftlichen Monografien über Sammelbände bis zu praxisnahen Handreichungen. Hinzu kommen zwölf wissenschaftliche Zeitschriften aus unterschiedlichen Fachbereichen, die wir technisch und organisatorisch hosten und bei denen wir für die Einhaltung von fachspezifischen Qualitätssicherungsverfahren einstehen. Für dieses Jahr sind zahlreiche weitere Bücher und die Aufnahme neuer Zeitschriften geplant. Besonders spannend finden wir, dass zunehmend auch innovative Formate nachgefragt werden – etwa Publikationen, die Forschungsdaten oder audiovisuelle Materialien integrieren. Das zeigt, dass BerlinUP nicht nur klassische Publikationswege unterstützt, sondern auch neue Formen des wissenschaftlichen Publizierens erprobt.
Wie unterstützt BerlinUP Forschende dabei, Open Access umzusetzen?
Unabhängig davon, ob es letztlich zu einer Publikation bei BerlinUP kommt, beraten wir die Forschenden zu allen Themen rund um das wissenschaftliche Publizieren, beispielsweise zu Lizenzen des Open Access, zur Wahl eines passenden Verlags bzw. einer Zeitschrift, Open-Access-Vorgaben von Förderinstitutionen und vielem mehr. Ziel ist es, unseren Forschenden durch konkrete Beratung Wissen zu vermitteln und ihnen damit mehr Zeit für die Forschung zu ermöglichen.
Welche Rolle spielt die Qualitätssicherung bei der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen?
Qualität ist für die wissenschaftliche Anerkennung natürlich entscheidend. Deshalb arbeitet BerlinUP nach etablierten Standards: Alle Publikationen durchlaufen ein Peer-Review-Verfahren oder ein vergleichbares qualitätssicherndes Verfahren. Zusätzlich achten wir auch sehr auf formale Qualität: professionelles Lektorat, Layout und möglichst barrierearme digitale Formate.
Welche Vorteile ergeben sich aus der Kooperation zwischen den vier BUA-Partnerinstitutionen?
Die Zusammenarbeit der vier Universitäten ist die eigentliche Stärke von BerlinUP. Keine Einrichtung allein könnte eine solche Infrastruktur in gleicher Breite und Stabilität aufbauen. Gemeinsam bündeln wir Expertise, teilen Ressourcen und können ein Verlagsprogramm anbieten, das die gesamte Forschungslandschaft Berlins abbildet. Alle Partner bringen ihre Stärken ein: die TU Berlin im Bereich Bücher, die FU Berlin bei Journals, HU Berlin und Charité mit Beratungsexpertise. So entsteht ein gemeinsames Portfolio, von dem alle profitieren. Gleichzeitig senden wir mit dieser Kooperation ein Signal: Wissenschaftliche Einrichtungen können gemeinsam tragfähige Alternativen zu kommerziellen Strukturen schaffen – nachhaltig, qualitätsorientiert und zum Nutzen aller.
Welche Rolle spielt BerlinUP innerhalb der Berlin University Alliance?
BerlinUP ist ein Schaufenster für das, was die BUA unter Offener Wissenschaft versteht: Der Verlag macht die Forschungsergebnisse sichtbar, stellt sie weltweit zur Verfügung und trägt so zur Profilbildung des Verbunds bei. Wir setzen zentrale Ziele der BUA wie „Research Quality and Value“ und „Sharing Resources“ um, indem wir qualitätsgeprüfte Publikationsmöglichkeiten und geteilte Infrastrukturen schaffen. Darüber hinaus ist BerlinUP ein praktisches Beispiel dafür, wie die Zusammenarbeit im Exzellenzverbund funktioniert: gemeinsam finanzierte Infrastruktur, die allen Partnern zugutekommt und zugleich über die BUA hinauswirkt. Gleichzeitig steigern wir die Sichtbarkeit der BUA nach außen. Dass vier große Einrichtungen einen gemeinsamen Verlag gründen, hat bundesweit Beachtung gefunden.
Was hat sich mit BerlinUP verändert, auch für die BUA-Partnerinnen und ihre Forschenden?
BerlinUP ist als ambitioniertes Projekt der BUA gestartet und Ende 2023 in den Dauerbetrieb als Verlag mit einer entsprechenden Governance überführt worden. Diese veränderten, organisationellen Rahmenbedingungen wirken vor allem im Hintergrund und sichern das Verlagsangebot langfristig ab. Für Forschende hat sich vor allem die Publikationslandschaft erweitert. Sie haben mit BerlinUP die Möglichkeit, Open Access auf höchstem Qualitätsniveau zu publizieren, ohne finanzielle Hürden. Besonders Nachwuchswissenschaftler*innen ohne große Budgets nutzen dieses Angebot. Auch die Einrichtungen selbst profitieren: Bibliotheken tauschen sich enger aus, Open Access ist sichtbarer geworden, und Fachzeitschriften haben den Schritt zu Open Access geschafft. BerlinUP holt ein Stück Kontrolle zurück in akademische Hand.
Wie gehen Sie mit neuen Technologien wie Künstlicher Intelligenz im Publikationsprozess um?
Wir beobachten den Einsatz von KI sehr aufmerksam und haben 2024 einen Leitfaden zum Umgang mit KI veröffentlicht. Darin ist klar: KI kann bei der Textaufbereitung helfen, aber wissenschaftliche Verantwortung und Qualitätskontrolle bleiben beim Menschen.
Welche Maßnahmen ergreift BerlinUP, um Barrierefreiheit sicherzustellen?
Barrierearme Gestaltung ist ein zentrales Handlungsfeld. Bei der Gestaltung unserer Webseite sowie digitalen Plattformen und Infrastrukturen sind wir gut aufgestellt und achten darauf, die entsprechenden Vorgaben und Richtlinien zu erfüllen. Wir möchten, dass unsere Seiten für alle Menschen zugänglich und nutzbar sind. Darüber hinaus unterstützen wir Autor*innen und Herausgeber*innen bei der barrierearmen Gestaltung ihrer Publikationen. Schon beim Schreiben gilt es, bestimmte Dinge zu beachten – dafür stellen wir Informationen bereit, geben Tipps, helfen bei Fragen. Wir arbeiten eng mit den Herausgeber*innen und Autor*innen zusammen, um die barrierearme Aufbereitung der digitalen Inhalte sicherzustellen.
Was motiviert Sie persönlich, sich für Open Access und BerlinUP einzusetzen?
Offene Wissenschaft ist mir ein wichtiges Anliegen. Alle Menschen sollten vom Wissenszuwachs profitieren, den die Forschenden hier in Berlin und weltweit generieren. Und das geht am besten, wenn die Publikationen und Daten frei zugänglich sind. Freier Zugang stärkt Innovationskraft, interdisziplinäre Zusammenarbeit und letztlich auch die Wettbewerbsfähigkeit des Wissenschaftsstandortes Berlin. Außerdem ist es die Basis für solide wissenschaftseigene Prozesse zur Qualitätssicherung.
Gibt es ein besonderes Projekt oder eine Publikation bei BerlinUP, auf das Sie besonders stolz sind?
Es fällt schwer, ein einzelnes Beispiel hervorzuheben, da wir aus ganz unterschiedlichen Fächern spannende Publikationen begleiten durften und ich mich über jede Publikation freue, die wir frei zugänglich machen konnten. Darin liegt für mich die größte Erfüllung.
Die Interviewfragen stellte Stefanie Terp.