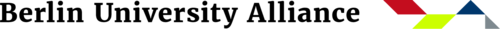Und wie kann man sich diesen präzisen „tiefen Blick“ in die Zelle vorstellen?
Mit einer Biopsie entnehmen wir Gewebe, in dem sich viele verschiedene Zellen befinden. Mit modernen Techniken sollen nun Einzelzellen, ihr Sitz im Gewebezusammenhang, ihre Beziehungen zueinander und ihr Verhalten identifiziert werden, zum Beispiel ihre Interaktion mit Proteinen oder auch die Struktur der darin befindlichen Moleküle. Um diese Dinge in ihrer Tiefe analysieren zu können, werden zahlreiche Datensätze benötigt, die mit vielen unterschiedlichen Technologien erhoben werden. Wenn man diese Daten zusammenführt, was wiederum eine aufwendige Aufgabe der Bioinformatik ist, betrachtet man das als sogenannte Systemmedizin. Wir müssen also sehr unterschiedliche Faktoren erheben, um das persönliche Risikoprofil einer Person zu ermitteln, zum Beispiel die Erbinformationen, die spezifische Proteinzusammensetzung in der Zelle oder die Besiedelung mit Bakterien und Viren. Wie unterscheiden sich die Zellen eines gesunden Menschen von denen eines Kranken oder einer Person mit bekanntem Risikoprofil? Können wir erkennen, bei wem die Krankheit demnächst ausbrechen könnte? Und wie können wir Signalwege beeinflussen, um das zu verhindern? Viele Signale, die bestimmte Erkrankungen vorantreiben, die also die Vorgänge in und um die Zelle beeinflussen, kennen wir bereits. Wir wollen aber umgekehrt auch die Schlüsselwege finden, die zu einer Gesunderhaltung beitragen ...
… und so eine personalisierte Medizin entwickeln?
Genau. Denn wenn wir die Schlüsselwege kennen, können wir dort gezielt therapeutisch angreifen – und dann jede einzelne Person optimal behandeln.
Spielt dabei auch die Ernährung eine Rolle?
Klar ist: Wenn ich Lebensmittel esse, die nicht in hohem Maße industriell verarbeitet wurden, bleibe ich gesünder. Ein Projektziel ist es aber darüber hinaus, die spezifischen Stoffe in der Nahrung zu identifizieren, die gesunderhaltende Mechanismen in den Zellen fördern. In Kooperation mit dem Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam werden wir bald entsprechende Strategien untersuchen.
Was muss sich in der Ausbildung ändern, um diese Medizin der Zukunft zu realisieren?
Wir brauchen dafür mehr Mediziner*innen, die sich über das Therapieren von Krankheiten hinaus auch mit Wissenschaft beschäftigen. Deshalb haben wir an der Charité vor etwa 13 Jahren das „BIH Charité Clinician Scientist Programm“ gegründet. Damit wollen wir Interessierte in der ärztlichen Weiterbildung abholen. Sie können drei Jahre lang 50 Prozent ihrer Weiterbildungszeit für Wissenschaft nutzen. Für das Ausbildungsprogramm von „ImmunoPreCept“ ist die fächerübergreifende Interaktion ein zentrales Element. Mediziner*innen, Immunolog*innen, Systembiolog*innen, Informatiker*innen und Kommunikationswissenschaftler*innen sollen zusammen in der gesamten Qualifizierungsphase vom Studium bis hin zur Postdoc-Phase ausgebildet werden. So lernen sie frühzeitig, sich gegenseitig zu verstehen, quasi die gleiche Sprache zu sprechen. Nur so können sie neue wissenschaftliche Fragen entwickeln und schließlich gemeinsam beantworten.
Sie sind Mitglied in wissenschaftlichen Gesellschaften wie der Leopoldina, in Gremien aktiv sowie als Vizepräsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der DFG. Wie bringen Sie Ihr vielfaches Engagement unter einen Hut?
Ich bin in dem System groß geworden. Zum Beispiel hat die DFG meine Ausbildung und meinen wissenschaftlichen Weg bis zum Lehrstuhl zu über 80% finanziert: so den Postdoc-Aufenthalt an der University of Colorado, USA, meine Facharztausbildung, eine Emmy-Noether-Nachwuchsgruppe und eine Heisenberg-Professur. Deshalb möchte ich etwas zurückgeben, indem ich dieses System mitgestalte und auch bereit bin, Verantwortung zu tragen.
Vielen Dank für das Gespräch!
Interview: Patricia Pätzold
Bildcredits: Charité – Universitätsmedizin Berlin / Charité I Jacqueline Hirscher / Charité I Janine Oswald