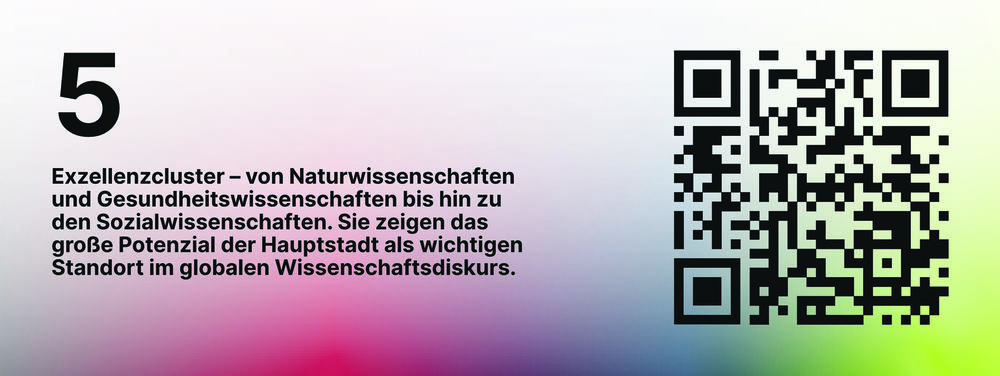Die 100 wichtigsten Köpfe der Berliner Wissenschaft. Folge 6: Sie haben den Gemeinsinn im Blick
06.10.2025
Unsichtbare Ausbeutung, Verlustangst, politische Radikalisierung – diese Forschenden schauen genau auf soziale Zusammenhänge und werfen ethische Fragen auf.
-
Prof. Dr. Gökçe Yurdakul (Humboldt-Universität zu Berlin): Die Soziologin Gökçe Yurdakul erhielt in diesem Jahr eine prestigeträchtige Förderung des Europäischen Forschungsrats in Höhe von 2,5 Millionen Euro für ihr Projekt „Menbelong“. Darin untersucht sie, wie alleinstehende Männer mit Migrationshintergrund Zugehörigkeit erleben – jenseits gängiger Stereotype von Kriminalität oder Integrationsverweigerung. Yurdakul war 2023/24 Ko-Direktorin des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung (BIM).
-
Dr. Milagros Miceli (Technische Universität Berlin): Das US-Magazin „Time“ nannte sie vor kurzem eine der 100 einflussreichsten KI-Persönlichkeiten. Die Soziologin und Informatikerin an der TU und am Weizenbaum-Institut erforscht die sozialen und ethischen Folgen Künstlicher Intelligenz. In ihrem Projekt „Data Workers’ Inquiry“ rückt sie die oft unsichtbare Arbeit von Datenarbeiter:innen ins Zentrum.
-
Dr. Eylem Kanol (Freie Universität Berlin): Der Soziologe interessiert sich für besonders extreme Phänomene: Wie kommt es zu politischer oder religiöser Radikalisierung? Woher kommt Extremismus und Fundamentalismus? Und wie kann das zu gesellschaftlichen Bewegungen führen? Zuletzt zeigte Kanol, wie Verschwörungsglauben in Krisenzeiten negative Einstellungen gegenüber gesellschaftlichen Minderheiten verstärkt.
-
Dr. Hanno Hochmuth (Freie Universität Berlin): Der Historiker verbindet Forschung und Lehre mit praktischer Erinnerungskultur. Gemeinsam mit Studierenden des Masterstudiengangs Public History an der FU Berlin recherchierte er Biografien NS-verfolgter Jüdinnen und Juden. Als Ergebnis werden nun 20 weitere Stolpersteine in Berlin verlegt. Hochmuth selbst schildert in seinem Buch „Berlin. Das Rom der Zeitgeschichte“ die Geschichte der jüdischen Familie Najman. Gerade jetzt wichtige sichtbare Zeichen gegen das Vergessen.
-
Prof. Dr. Andreas Reckwitz (Humboldt-Universität zu Berlin): Wertvolle Denkanstöße kommen vom Soziologen Reckwitz, wenn es um das Thema gesellschaftliche Resilienz geht. In seinem Buch „Verlust. Ein Grundproblem der Moderne“ analysiert er, warum viele Menschen die Zukunft heute als Bedrohung erleben. Statt purem Fortschrittsglauben oder bloßen Untergangsszenarien plädiert er für einen klügeren Umgang mit individuellen und gesellschaftlichen Verlusten.
-
Prof. Dr. Thorsten Faas (Freie Universität Berlin): Wie kaum ein anderer hat der Politikwissenschaftler die Bundestagswahl 2025 erklärt. Mit scharfem Blick und in verständlicher Sprache legte er die Mechanismen, Trends und Überraschungen hinter den Zahlen dar. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf politischen Einstellungen und politischem Verhalten von Bürger:innen.
-
Dr. Julien Colomb (Technische Universität Berlin): Eigentlich Genetiker und spezialisiert auf die Taufliege, engagiert sich Colomb seit vielen Jahren in der „Maker“-Szene. Das Milieu ermutigt Leute innerhalb und außerhalb der Forschung dazu, Maschinen, Versuchsanordnungen und technische Bauteile einfach selbst zu bauen, statt sie von Konzernen zu kaufen. Und sie als „Open Hardware“ frei für alle zugänglich zu machen. Nun betreut er zu diesem Zweck mit Robert Mies die offene Hightech-Werkstatt „Open Make“ der Berlin University Alliance.
Sie alle wurden heute im Tagesspiegel (06.10.2025) im Rahmen der Serie „Die 100 wichtigsten Köpfe der Berliner Wissenschaft“ vorgestellt. Mehr im Tagesspiegel (T+).